Die Kenianer nennen sie nur „Mama Mutig“. Zum einen, weil Rebecca Lolosoli das erste Frauendorf Afrikas gründete. Zum anderen, weil sie jetzt auch noch in die Politik gehen will. Die Samburu-Männer verstehen die Welt nicht mehr
Den Tag, an dem Mama Meroni starb, wird Rebecca Lolosoli nie vergessen. Er hat sich förmlich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Gerade einmal neun Jahre alt war sie damals, als die Frau aus dem Dorf sie und die anderen Kinder wie immer zum Holzsuchen mitnahm. An diesem Tag vergaßen sie die Zeit und kamen später zurück als gewohnt. Dafür musste Mama Meroni, mit der sie so gerne Lieder gesungen und gespielt hatte, mit dem Leben bezahlen: Der eigene Ehemann erschlug sie vor den Augen der Kinder mit einem Stock. Einfach so. Und niemand aus dem Dorf verlor ein Wort darüber. Als ob nichts passiert wäre. In diesem Moment schwor sich Rebecca, später einmal etwas gegen dieses Unrecht zu tun.
Ihren Kampfgeist, erzählt sie bei ihrem Europabesuch, habe sie von ihrem Vater geerbt. Einem der letzten großen Samburu – Stammesführer, der als Nomade für seine Führungsstärke bekannt und angesehen war. Rebecca war seine Lieblingstochter, sie ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. „Er nahm mich mit zu den Friedensverhandlungen, ließ mich Ziegen und Kühe hüten. Alles, was sonst nur Jungen tun dürfen“, sagt sie. Das habe sie geprägt. Bis heute. Ihr Vater hat sie zu einer selbstbewussten Frau erzogen, die ausspricht, was sie denkt und die Widerworte gibt. In der männerdominierten Samburu-Kultur ein Unding. Dort haben Frauen seit jeher einfach zu gehorchen. Was zu tun ist, lernen sie automatisch von ihren Müttern. Kochen, putzen, Holzsammeln. Den ganzen Tag lang rackern wie Lasttiere. Immer im Glauben, eheliche Gewalt und die qualvolle Beschneidung seien etwas völlig Normales. Die Jungen wiederum bekommen von klein auf von den Vätern den Satz eingebläut: „Wer eine Frau nicht schlägt, ist nicht normal“.
Mit ruhiger, fester Stimme erzählt die Nomadin ihre eigene Geschichte. Schildert, wie sie als junges naives Mädchen selbst die Beschneidung einforderte und die Frauen sie dabei festhalten mussten, weil sie die Schmerzen kaum aushielt. Sie die Prozedur am nächsten Tag sogar noch ein zweites Mal über sich ergehen ließ und deshalb beinahe ihr Leben verlor. Wie schon so viele Frauen vor ihr. Sie offenbart, wie sie ihre Ehe mit einem gewalttätigen Mann viele Jahre ertrug und schließlich von einem Schlägertrupp ihres Schwiegervaters in ihrem Laden überfallen und halb totgeschlagen wurde. Weil sie nicht die unterwürfige Schwiegertochter war, die er sich gewünscht hatte.
Während Rebecca spricht, gleiten ihre Finger immer wieder über die Kette, die an ihrem goldenen Ohrring befestigt ist. Das sei ihr Ehering, verrät sie. Sie trägt ihn immer noch, obwohl sie seit 2010 von ihrem Mann geschieden ist. „Wenn man einmal verheiratet war, behält man den Ring für immer. Auch als geschiedene Frau. Genauso wie die Hochzeitskette“. Sie deutet auf den bunten Perlenschmuck, den sie um den Hals trägt. Eigentlich, sagt Rebecca, habe der Arzt ihr verboten, die Kilo schweren Ketten zu tragen. Geschweige denn zu reisen. Zu sehr wurde ihr Rücken bei dem letzten Überfall auf sie in Mitleidenschaft gezogen. Wieder war es ein Schlägertrupp. Vermutlich vom Exmann beauftragt. Letzten Dezember. Sie lächelt und zeigt auf eine Lücke in ihrer unteren Zahnreihe. Auch das ein „Andenken“ ihrer Ex-Verwandtschaft, die von Anfang an voller Neid und Missgunst war. Denn alles, was Rebecca anpackte, gelang ihr: Sei es, dass sie von früh bis spät die Familie ihres Mannes bekocht hatte. Oder sich die Ziegenzucht unter ihrer Obhut prächtig entwickelte. Auch das kleine Geschäft, das sie eröffnet hatte, florierte. Doch gerade der Laden war ihrem Schwiegervater ein Dorn im Auge: Er wurde nämlich mit der Zeit immer mehr zur Anlaufstelle für die Samburu-Frauen in Not.
Bei Rebecca schütteten sie ihr Herz aus, wenn sie – was häufig passierte- von britischen Soldaten vergewaltigt worden und schwanger geworden waren. „Point Five heißen diese Mischlingskinder, weil sie eben halb und halb sind. Dann waren da noch die Frauen, die von ihren Ehemännern grundlos verprügelt wurden. Immer häufiger erzählten mir Frauen, dass sie am liebsten von zu Hause weglaufen und vor ihrem Ehemann fliehen würden. Und plötzlich war sie da: die Idee, Umoja zu gründen. Ein Dorf für Frauen. Einen Zufluchtsort.“
Umoja ist Suaheli und bedeutet übersetzt „zusammen“. „Denn nur zusammen konnten wir stark sein“, sagt Rebecca. Für umgerechnet 1000 Euro kaufte sie 1990 zusammen mit 15 anderen Frauen ein Stück Land. Das Geld hatten sie sich vom Munde abgespart. Sie bauten Hütten, eine Schule und Unterkünfte für Touristen. Seither leben ständig rund 50 Frauen mit ihren Kindern in Umoja. „Es steht allen Frauen offen zu kommen und zu gehen, wann sie wollen. Und: Alles bei uns wird demokratisch und gemeinschaftlich entschieden“, versichert „Mama Mutig“.
Sie betont, dass es ihr nicht darum gehe, die Männer auszugrenzen oder Frauen aus den Familien zu reißen, sondern deren Bewusstsein für ihre Rechte zu stärken. „In unserem Dorf werden deshalb regelmäßig Workshops über Frauenrechte und Genitalverstümmelung abgehalten. Eine sehr emotionale Angelegenheit, bei der den Frauen erst bewusst wird, welches Unrecht sie ertragen haben.“ Dank Internet haben viele von ihnen ein Netzwerk gegründet, dem inzwischen 60 Frauengruppen angehören. Sie alle tauschen sich aus, organisieren sich.
Rebeccas Aufklärungsarbeit trägt allmählich Früchte. „Immer mehr Mädchen wehren sich dagegen, beschnitten zu werden und laufen zur Polizei. Oder sich als Dreizehnjährige mit einem Sechzigjährigen verheiraten zu lassen“ erzählt die Kenianerin, die selbst nicht so genau weiß, wie alt sie wirklich ist. Viele Samburu-Männer indes könnten gar nicht glauben, wie ihnen geschieht und gucken verdutzt, wenn die Frau nun sagt: ‚Hol Dir das Wasser selbst’“.
Zwischendurch gebe es aber auch immer wieder bittere Rückschläge. Rebecca berichtet von einer Frau, die in Umoja Zuflucht vor ihrem gewalttätigen Mann gesucht hatte und nur noch einmal schnell zurück in ihr Dorf wollte, um noch etwas von zuhause zu holen: „Ich habe sie noch gewarnt. Sie kehrte nicht mehr zurück. Ihr Mann erschlug sie.“ Die Frauen in Umoja beratschlagten und Rebecca zeigte den Täter schließlich an. Zum ersten Mal wurde ein Samburu-Mann für Totschlag zu sieben Jahren Haft verurteilt, sagt sie stolz. Ein echter Durchbruch.
Trotzdem machen die Samburu-Männer den Frauen von Umoja das Leben weiterhin schwer. Ab und zu knöpfen sie ihnen das Geld ab, das die Frauen mit dem Verkauf von Perlenschmuck an Touristen verdienen. Oder die Männer sperren die Strasse, um so Besucher vom Dorf fernzuhalten. Auch Rebeccas Ex-Mann gibt nicht auf. Einmal tauchte er mit einem Gewehr in Umoja auf und drohte, sie umzubringen. „Wenn ich das als Frau gemacht hätte, wäre ich dafür ins Gefängnis gekommen. Er als Mann nicht“, bemerkt sie trocken. Aus Angst vor einem erneuten Überfall tauchte sie mehrere Wochen in Nairobi unter. Geld für einen Wachmann habe sie nicht, und sich zu bewaffnen komme für sie nicht in Frage. „Ich will nicht zur Mörderin werden“ sagt sie. Inzwischen streitet ihr Ex-Mann mit ihr vor Gericht um das Land, auf dem Umoja steht, und schreckt dabei vor nichts zurück. „Er hat meine Grundstücks-Papiere gestohlen, meine Kinder gegen mich aufgehetzt und sie dazu gebracht, vor Gericht schriftlich zu bezeugen, dass ich eine Alkoholikerin bin und geisteskrank.“
Damit spricht Rebecca einen kritischen Punkt an. Denn die Jungen, die bei ihnen im Dorf aufwachsen und den respektvollen Umgang mit den Frauen lernen, geraten später zwischen die Fronten, sobald sie draußen ihre Väter treffen. Gewissenskonflikte sind vorprogrammiert. Die junge Generation der Samburu-Männer sitzt zwischen den Stühlen. Manche von ihnen sehen sich zum Glück aber auch als Mittler der Eltern, das stimmt Rebecca optimistisch.
Sie selbst bewegt sich auch in zwei Welten: In Umoja, wo sie so gerne auf dem Boden bei den Ziegen schläft und in modernen, westlichen Ländern, in denen sie mit Handy und Laptop im Flieger unterwegs ist. Komfort und Luxus kann die Kosmopolitin jedoch nicht viel abgewinnen. „Wenn ich im Hotel schlafe nehme ich mir die Decke und lege sie auf den Boden.“ Ein wenig Umoja-Gefühl in der Ferne. Nur ohne Ziegengemecker.
Bei ihren Reisen rund um den Globus erzählt Rebecca von ihrem Dorf und macht dabei auch Mädchen aus anderen Kulturen Mut, für ihre Rechte zu kämpfen. Von Hillary Clinton erhielt sie 2010 deshalb den „Natural Born Leader-Preis“.
Diese Auszeichnung steht für den Mut und das Engagement der Samburu-Frau, die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Ohne die Unterstützung von Organisationen, sondern aus eigenem Antrieb. Und ihre Geschichte ist noch nicht lange nicht zu Ende. Ihr nächstes Ziel ist es, sich im März 2013 in den Samburu – Gemeinderat wählen lassen. Als erste und einzige Frau unter sieben männlichen Mitbewerbern. Von denen einer ihr Ex-Mann ist. „Obwohl er sich vorher nie dafür interessiert hat“, bemerkt sie mit ironischem Unterton. Ihre Kandidatur, fügt sie hinzu, sei übrigens auch der Grund für den letzten Überfall gewesen. „Das war sein Versuch, mich zur Aufgabe zu zwingen.“ Doch Rebecca macht weiter. Wie und wovon sie ihren Wahlkampf bestreiten will, weiß sie noch nicht genau, aber sie will sich von nichts und niemandem aufhalten lassen. „Und wenn ich tagelang durch den ganzen Wahlkreis zu Fuß gehen muss“, sagt sie kämpferisch. Ihr Vater wäre stolz auf sie.
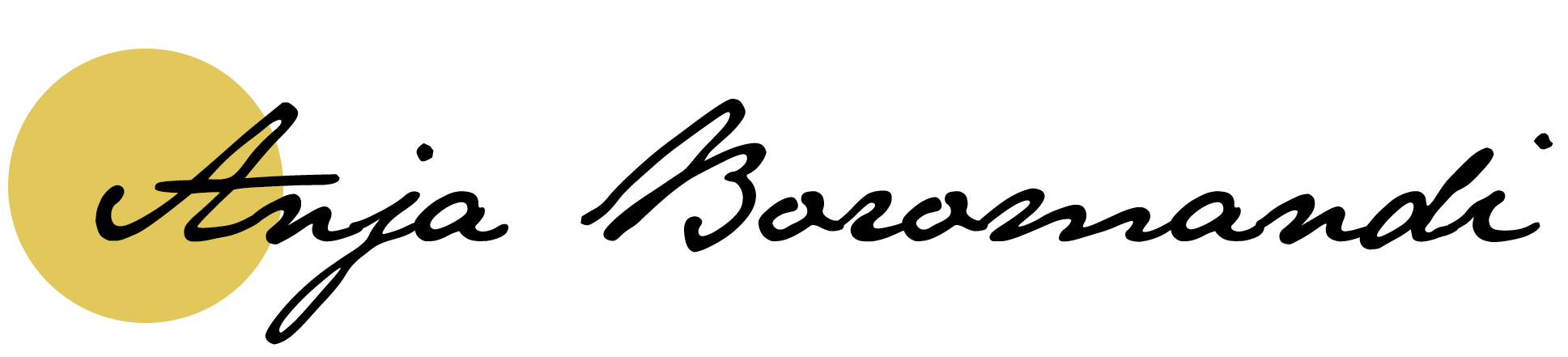

Kommentar hinzufügen